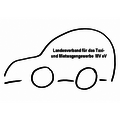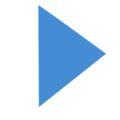- Online-Abrechnung
- Software
- Für wen
- Preise
- Wissen
Fachkräftemangel in Therapieberufen
In Deutschland mangelt es an Therapeuten – egal, ob Physiotherapeuten, Logopäden oder Ergotherapeuten. Wir erklären, was die möglichen Ursachen für den Fachkräftemangel in den Therapieberufen sind und was wir dagegen machen können. Außerdem: Alle Infos zur Vollakakdemisierung und zur Teilakademisierung der Heilmittelberufe.
Inhaltsverzeichnis: Gebündeltes Wissen zum Fachkräftemangel im Umfeld der Therapieberufe
Gibt es unter den Therapieberufen einen Fachkräftemangel? Wie ist die aktuelle Lage in Deutschland?
Es gibt einen Fachkräftemangel in vielen Bereichen des deutschen Gesundheitssystems. Viel zu wenig Fachkräfte stehen zur Verfügung und haben zudem oft mit einer hohen Belastung zu kämpfen. Das ist auch bei den Therapieberufen wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie zu erkennen.
Beispielsweise wurde 2016 in sieben Bundesländern ein klarer Mangel an Physiotherapeuten ermittelt. Schon 2019 waren das bereits 14 Bundesländer! Lediglich in Hamburg bestand kein Physiotherapeuten-Fachkräftemangel, während in Bremen aufgrund zu weniger Daten keine Beurteilung vorgenommen werden konnte. (Diese Auswertungen basieren auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.) Und die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) erklärte 2021: „Mittlerweile spüren die Krankenhäuser verstärkt den Fachkräftemangel und haben trotz großen Engagements erhebliche Probleme, offene Stellen im Bereich der Physiotherapie zu besetzen.“ Für die DRK ist es derzeit „dringend erforderlich, die Attraktivität dieser Berufe zu steigern.“
Einen solchen Fachkräftemangel gibt es nicht nur in der Physiotherapie, sondern auch in anderen Heilmittelberufen. Die Studie „Ich bin dann mal weg“ der Hochschule Fresenius hat beispielsweise ergeben, dass rund jeder zweite Therapeut mit dem Gedanken spielt den Beruf zu wechseln.

Mögliche Gründe für einen Fachkräftemangel in den Therapieberufen / Heilmittelberufen
Lässt sich ein Fachkräftemangel im Umfeld der Heilmittel- und Therapieberufe erklären? Sind die Gründe für diesen Trend ersichtlich? Im Folgenden versuchen wir, die möglichen Ursachen für einen Fachkräftemangel zu definieren.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sagte 2021: „Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Mangel aufgrund des demographischen Wandels in den kommenden Jahren noch verstärken wird.“ Zum einen gehen mehr Therapeuten in Rente als neue nachrücken. Zum anderen sorgt die Alterung der Gesellschaft auch, dass es mehr (ggf. sogar chronisch kranke) Menschen geben wird, die Heilmittel benötigen.
Der digitale Wandel eröffnet neue Chancen und Möglichkeiten im Gesundheitswesen, aber stellt die Leistungserbringer auch vor Hürden, die nicht alle Beteiligten gleich gut überwinden können. Teletherapie oder datenschutzrechtliche Maßnahmen können Menschen möglicherweise abschrecken. Und dass auch das gesamte Gesundheitssystem sich mit der Digitalisierung schwer tut, zeigt der stockende Einstieg in die Telematikinfrastruktur, die sämtliche Akteure des Gesundheitswesens miteinander vernetzen soll.
Oft wird kritisiert, bei den Therapieberufen in Deutschland fehle die internationale Vergleichbarkeit. Beispielsweise bei ausländischen Therapeuten, die nach Deutschland kommen wollen, oder jene Deutsche, die im Ausland arbeiten wollen. „Es ist nicht akzeptabel, dass die Berufsfreiheit in der EU für die Therapieberufe nur eingeschränkt möglich ist“, urteilt Professor Bernhard Borgetto vom Bündnis „Therapieberufe an die Hochschulen“. Zwar kommt hier die EU-Anerkennungsrichtlinie zum Einsatz, aber dennoch seien Irritationen aktuell vorprogrammiert. Ein anderes Problem der fehlenden Vergleichbarkeit betrifft zudem den interkulturellen Austausch in der Forschung.
Abschreckend könnte auf Berufsinteressenten auch die fehlende Autonomie wirken. Bisher gibt es keinen Direktzugang zu Heilmitteln. Immerzu ist der Umweg über den – oft eh schon überlasteten – Arzt notwendig und ohne ein Rezept kann keine therapeutische Leistung erbracht werden. „Zudem sorgt das auch für Unzufriedenheit unter den Kollegen, wenn Kompetenzen, die in unserer Berufsgruppe vorhanden sind, nicht abgeholt werden“, sagt Dagmar Karrasch vom Deutschen Bundesverband für Logopädie (dbl). „Wir sehen leider immer wieder, dass Therapeuten ihren Beruf wechseln. Auch aufgrund der wirtschaftlichen und hierarchischen Rahmenbedingungen und der bisherigen Kompetenzverteilung. Wenn ich Leistungen erbringen könnte, die meinen Patienten mehr nützen, aber ich sie in dieser Form nicht erbringen darf, weil das einfach nicht vorgesehen ist.“
Die zuvor genannte fehlende Autonomie sorgt mit dafür, dass Therapeuten das Gefühl haben könnten, im Gesundheitssystem eher zweitrangig zu sein. Eine fehlende Wertschätzung sehen viele auch bezüglich der Politik und bei den Krankenkassen. Beispielsweise lässt die überaus niedrige Hygienepauschale, die zu Beginn der Corona-Pandemie eingeführt wurde, vermuten, dass es der Gesetzgeber nicht ernst mit den Therapeuten meint. „Wir müssen uns vor Augen führen, es geht hier um Infektionsschutz in einer Pandemie. Vollkommen unverständlich, dass an dieser Stelle gespart wird“, urteilt Marcus Troidl vom VDB-Physiotherapieverband. (Zum einen ist die Hygienepauschale in Höhe von 1,50 Euro sehr niedrig angesetzt, zum anderen gilt sie nicht pro Termin, sondern pro Rezept. Werden ggf. zehn oder 20 Therapieeinheiten verordnet, dann fließt am Ende ggf. bis nur 7,5 Cent pro Termin in die Desinfektion eines Therapieraums.) Darüber hinaus wird aber auch kritisiert, dass die fehlende Wertschätzung in der gesamten Gesellschaft zu spüren sei. „Von Patientenseite werde ich regelmäßig gefragt, ob ich denn gern massiere“, erzählt die Physiotherapeutin Isabella Hotz, „ich wurde auch schon mal als ‚Massiermaus’ bezeichnet. Oder bei Ergotherapeuten heißt es gelegentlich, dass deren Arbeit ja nur aus ‚mit Kindern zusammen kneten‘ bestehen würde.“
Und schließlich trifft die Therapieberufe auch ein Kritikpunkt, der auch bei anderen Leistungserbringern im Gesundheitssystem anzutreffen ist: zu niedrige Bezahlung. Niedrige Tarife durch die Krankenkassen (siehe das zuvor genannte Beispiel mit der Hygienepauschale) müssen auch im vergleichbaren Maß an die Angestellten weitergegeben werden. Hohe Löhne sind bei Kassenleistungen unmöglich. Für manche Interessierten könnte das abschreckend wirken; ggf. rücken manche deshalb vom Berufswunsch des Physiotherapeuten ab und wählen stattdessen den Weg des Mediziners.

„Therapeuten werden eher ‚mittelprächtig‘ bezahlt – obwohl man ja wirklich einen wichtigen Teil zur Versorgung der Gesellschaft beiträgt. Einer der Gründe für den Fachkräftemangel und die hohe Berufsflucht.“
Isabella Hotz
Physiotherapeutin und aktiv im Netzwerk „HochschuleJetzt!“
Therapieberufe attraktiver machen und den Fachkräftemangel beseitigen
Manche Maßnahmen, die den Fachkräftemangel in Therapieberufen aufhalten sollen, werden bereits ausgeführt, wogegen andere noch diskutiert werden. Um gegen den Mangel entgegenzuwirken, sind viele Schritte notwendig. Die im Folgenden vorgestellten Maßnahmen sind also keineswegs abschließend.
Ein grundsätzliches Umdenken – Therapieberufe modernisieren
Vieles, was in der Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und in anderen Therapieberufen Standard ist, hat sich bereits vor vielen Jahrzehnten etabliert. Aber die Lage an sich hat sich heute längst verändert. „Zum einen erfordern die Entwicklungen im Gesundheitswesen eine Anhebung der Kompetenzen der Therapieberufe und entsprechend derAusbildungsstandards“, sagt Prof. Dr. Bernhard Borgetto von der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen (HAWK) sowie vom Bündnis „Therapieberufe an die Hochschulen“. „Denn der medizinische Fortschritt und der demografische Wandel machen auch vor den Therapieberufen nicht halt“, sagt er, „daher müssen die Therapieberufe endlich modernisiert werden.“ Hierfür ist es notwendig, den Heilmittelbereich komplett neu zu denken und in der Politik und in der Gesellschaft ein neues Verständnis zu vermitteln. Denkbar wären z. B. Maßnahmen, wie es im Bereich der Pflegeberufe mit der Konzertierten Aktion Pflege durchgeführt wurde.
Den Therapeuten mehr Verantwortung übertragen
Wie bereits oben genannt, mangelt es in den Therapieberufen an einer fehlenden Autonomie. Ein Direktzugang würde nicht nur Ärzte und das gesamte Gesundheitssystem entlasten, sondern auch die Attraktivität der Heilmittelberufe steigern. Erste Schritte sind beispielsweise die Befugnisse an Heilmittelerbringer, ausgestellte Rezepte an einzelnen Stellen eigenmächtig zu korrigieren. Oder auch die sogenannte Blankoverordnung: Die Ärzte stellen hier weiterhin die Rezepte für Heilmittel aus, aber können dabei viele Angaben offenlassen, so dass die Therapeuten auf Basis ihrer Expertise entscheiden können, in welchem Umfang eine Therapie stattfinden soll. „Die Blankoverordnung ist für uns kein Fortschritt“, urteilt beispielsweise Dagmar Karrasch vom Deutschen Bundesverband für Logopädie (dbl), „wir denken, die wirtschaftliche Verantwortung gehört dorthin, wo auch die fachliche Verantwortung und vor allem Expertise liegt.“ Aus diesem Grund sei für Dagmar Karrasch und viele andere Akteure im Heilmittelbereich nur der Direktzugang die richtige Maßnahme. „Es stellt sich dabei nicht die Frage, ob wir in eine direkte Versorgung eingebunden werden sollen, sondern wann“, erklärte Karrasch in einem weiteren DMRZ.de-Interview, „denn in den nächsten Jahren steigen die Versorgungsengpässe in der ärztlichen Versorgung.“
Eine grundsätzliche Reform der Berufsfachschulausbildungen
Die klassische Ausbildung von Therapieberufen findet an Berufsfachschulen statt. „Wir wissen, dass die berufsfachschulische Ausbildung ein Erfolgsmodell ist, dass sie eine große Beliebtheit hat und dass sie beim Arbeitgeber ankommt“, sagt Bernd Dietrich von der Allianz für Gesundheitsschulen, einer Initiative des Verbands Deutscher Privatschulverbände (VDP). „Und deswegen möchten wir auch die Rahmenbedingen verbessern.“ Denn trotz allen Erfolgs stehen diese heute stark in der Kritik. Die Ärztezeitung schreibt beispielsweise von „teilweise Jahrzehnte alten Ausbildungsverordnungen“. Aktuell wird daran gearbeitet, diese wieder auf Vordermann zu bringen und grundsätzlich zu reformieren. Beispielsweise erhofft sich dadurch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) eine spürbare Verbesserung in der Versorgungsqualität. „Insbesondere bei der Vermittlung von Kenntnissen in der Prävention und der Anwendung digitaler Dienste im Verlauf des Therapieprozesses besteht in der aktuellen Ausbildungsordnung erheblicher Reformbedarf“, so die DKG.
Modernisierung der Therapieberufe per Hochschulausbildung
Neben der klassischen berufsfachschulischen Ausbildung von Therapieberufen, gab es maximal Studiengänge in Form von berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildungen. Mit Blick auf die Ausbildungsstandards im Ausland wurde 2009 testweise eine rein hochschulische Ausbildung von Logopädie, Ergo- und Physiotherapie gestartet. Diese Modellstudiengänge waren weit patientenorientierter ausgelegt als rein therapiewissenschaftliche Studiengänge. Doch laut des Deutschen Verbands für Physiotherapie (ZVK) interessiert sich derzeit nur jeder zehnte angehende Physiotherapeut für eine Ausbildung an der Hochschule. Hinzu kommt, dass die Modellstudiengänge, also das Ausprobieren und Austesten, aktuell noch nicht als Regelstudiengänge etabliert wurden. Die Regelungen zu den Modellstudiengängen wurden mehrmals verlängert. „Ohne Zweifel hat die Bewältigung der Corona-Pandemie den Gesetzgebungsprozess für die Novellierung der Berufsgesetze in den Therapieberufen verzögert“, sagt auch sagt Bernhard Borgetto vom Bündnis „Therapieberufe an die Hochschulen“. Die aktuelle Regierung (Kabinett Scholz) hat derzeit die Aufgabe, über die Zukunft der Therapiestudiengänge zu entscheiden.
Mehr zu den ModellstudiengängenAbschaffung des Schulgelds in Berufsfachschulen
Bereits die letzte Bundesregierung (Kabinett Merkel IV) hat sich vorgenommen, dass Azubis bei der schulischen Therapeutenausbildung kein sogenanntes Schulgeld zahlen müssten. Gerade an Privatschulen, die laut des VSB-Physiotherapieverbands beispielsweise 83 Prozent der ausgebildeten Physiotherapeuten hervorbringen würden, ist Schulgeld nicht unüblich. Massage- und Physiotherapieschüler müssten beispielsweise monatlich zwischen 250 und 400 Euro aufbringen. Dank der politischen Maßnahmen wurde ein solches Schulgeld stückweise abgeschafft – aber aktuell noch nicht in allen Bundesländern. Derzeit gibt es noch keine durchgängige Schulgeldfreiheit in den Therapieberufen, was den Einstieg in die Branche derzeit erschwert. Eine komplette Schulgeldfreiheit (wie sie übrigens in vielen anderen Branchen lange Standard ist) würde neue Anreize zum Einstieg in einen Therapieberuf schaffen.
Mehr zur SchulgeldfreiheitEin erstes Gehalt: Die Vergütung in der Ausbildung
Neben der geplanten Abschaffung eines Schulgelds wird auch die Frage debattiert, ob die Ausbildung eines Therapieberufs nicht grundsätzlich vergütet werden soll. Eine solche Vergütung – nicht nur für die schulische, sondern auch für die hochschulische Ausbildung – kann ein attraktiver Anreiz für Berufseinsteiger sein. Immerhin beweist eine Vergütung, dass sie auch schon während der Ausbildung als zukünftige Fachkraft ernstgenommen werden. Aus diesem Grund strebt die aktuelle Bundesregierung (Kabinett Scholz) laut Koalitionsvertrag die Vergütung bei Ausbildungen von Gesundheitsberufen an. „Die Zahlung einer Ausbildungsvergütung ist ein Element, um einem Fachkräftemangel und einer möglichen Konkurrenz zwischen den Gesundheitsfachberufen und den verschiedenen Ausbildungsträgern effektiv entgegenzuwirken“, heißt es in einem Eckpunkte-Papier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Gesamtkonzept Gesundheitsfachberufe“ (PDF).
Die Zukunft der Ausbildung von Therapieberufen
Bei allen Konzepten und Plänen zur Erstellung neuer und zur Überarbeitung bestehender Ausbildungsformen bleibt weiterhin eine Sache offen: Wie genau sieht die Zukunft in der Ausbildung von Therapieberufen aus? Welches grundsätzliche Konzept soll vorangetrieben werden, um den Fachkräftemangel langfristig zu stoppen? Debattiert werden vor allem zwei Konzepte: die Vollakademisierung und die Teilakademisierung. Alle sind sich eines: Ja zu einer Reform der bisherigen Ausbildung sowie Ja zu der weiteren Verfügbarkeit einer rein hochschulischen Ausbildung. Aber die Frage ist: Sollen Therapieberufe in Zukunft ausschließlich an der Hochschule (Vollakademisierung) oder parallel zu etablierten berufsfachschulischen Ausbildung (Teilakademisierung) ausgebildet werden? Im Folgenden gehen wir auf die beiden Modelle weiter ein.

„Es ist dringend erforderlich, dass die Curricula und das Berufsgesetz, die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung sehr schnell und nachhaltig reformiert werden. Das Berufsgesetz ist von 1994! Das ist nicht nur pädagogisch veraltet, sondern vor allem auch inhaltlich.“
Wolfgang Oster
Physiotherapeut und stellvertretender Vorsitzender des VDB Physiotherapieverbands
Das komplette Interview:
Argumente für die Vollakademisierung der Therapieberufe
Die Ausbildung der Therapieberufe Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie Schritt für Schritt an die Hochschulen bringen – das ist der Plan jener, die die Vollakademisierung fordern. Der Hochschulverbund Gesundheitsfachberufe (HVG) empfiehlt für diese Einführung ein Übergangszeitraum von etwa 10 bis 15 Jahren. Im Folgenden erklären wir, welche Vorteile eine Vollakademisierung mit sich bringen würde.
Evidenzbasiert: Effektives Arbeiten auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse
Eines der zentralen Ziele der hochschulischen Ausbildung sei des laute des Bündnisses „Therapieberufe an die Hochschule“, Therapeuten zu „evidenzbasiertem Entscheiden und Handeln in der individuellen und interprofessionellen Patientenversorgung“ zu befähigen. Evidenzbasiert bedeutet: das Arbeiten auf der Basis empirisch zusammengetragener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse. „Häufig wird darunter missverstanden, dass es ausreicht, wenn irgendeine Institution darüber entscheidet, ob eine Therapieform grundsätzlich wirksam ist und bei bestimmten Diagnosen angewendet werden darf“, erklärt Bernhard Borgetto vom Bündnis. Worauf eine optimale Versorgung seiner Meinung nach basiert: „Auf der Anpassung der konkreten Entscheidungs-, Handlungs- und Interaktionsprozesse im individuellen Therapieverlauf, die sich (auch) an der jeweils besten verfügbaren externen Evidenz orientieren.“ Zudem sollen auch eigene wissenschaftliche Erkenntnisse bei einer solchen Versorgung genutzt werden. „Gerade die Reaktionen auf die Behandlung von Patienten im Laufe einer Therapiesitzung verschaffen Erkenntnisse, die wiederum vor dem Stand des verinnerlichten wissenschaftlichen Wissens reflektiert werden und in fortlaufende Entscheidungen einfließen“, so Borgetto.
Die Unteilbarkeit der Therapieberufe – und alle für ein gleiches Niveau ausbilden
Während die Verfechter der Teilakademisierung die hochschulische und berufsfachschulische Ausbildung nebeneinander fordern, wird die Unteilbarkeit der Therapieberufe von den Befürwortern der Vollakademisierung verlangt. „Ein Problem ist doch, dass es alleine in Deutschland – teilweise in selben Bundesländern – keine gleichen Standards für die Ausbildung gibt“, erklärt Isabella Hotz vom Netzwerk „HochschuleJetzt!“. Nach ihrem Verständnis müssen alle angehenden Ergotherapeuten, Logopäden und Physiotherapeuten auf dem jeweils gleichen Niveau die Ausbildung beenden. „Aus Patientensicht sollte es keine Frage des Glücks sein, ob man von jemanden mit einem guten oder nicht so guten Ausbildungsniveau behandelt wird“, so Hotz, „es ist also auch im Interesse der Patienten, dass alle Therapeuten die gleiche Ausbildung genossen haben und dass die gleichen Standards in den Ausbildungen gelten.“
Die Gegner der Vollakademisierung sind jedoch eher der Meinung, dass eine weit kleinere Gruppe an Therapeuten für dieses Ausbildungsniveau ausreichen (mehr dazu weiter unten). Beispielsweise Wolfgang Oster vom VDB-Physiotherapieverband behauptet, dass mit die größten Befürworter der Vollakademisierung vor allem jene sind, die selber hochschulisch ausbilden. Die Meisten der praktizierenden Therapeuten hingegen würde diese Meinung nicht haben so Oster im DMRZ.de-Interview.

Mehr Forschungsimpulse im Heilmittelbereich
Die hochschulische Ausbildung soll auch die Forschung zu der logopädischen, ergotherapeutischen und physiotherapeutischen Arbeit vorantreiben. Laut des Bündnisses „Therapieberufe an die Hochschule“ gingen bisher im Heilmittelbereich eher wenige Forschungsimpulse von Deutschland aus. Bereits 2012 forderte der Gesundheitsforschungsrat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, dass den Therapieberufen eine auf den eigenen Beruf bezogene Forschung ermöglicht werden müsse und diese auf europäischer und internationaler Ebene zu vertiefen sei. Eine Vollakademisierung würde (laut des Bündnisses) dieser Forderung mehr nachgehen als eine Teilakademisierung.
Fachpraktische Ausbildung direkt am Patienten
Schnell wird gemutmaßt, dass eine rein akademische Ausbildung eines Therapieberufs zu wissenschaftlich ablaufen könnte und den Patienten außer Acht lässt. Die Verfechter der Vollakademisierung betonen aber immer wieder, dass die Patientennähe auch in der hochschulischen Ausbildung sehr wichtig ist. „Der fachpraktische Anteil fällt nicht hinter den der (bisherigen) berufsfachschulischen Ausbildung zurück“, erklärt beispielsweise das Bündnis „Therapieberufe an die Hochschulen“. Der Praxisanteil eines Physiotherapiestudiums beispielsweise beträgt genauso wie bei einer berufsfachschulischen Ausbildung 1.600 Stunden am Patienten – z. B. im Krankenhaus, in der Reha oder in einer Praxis. „Der nennenswerte Unterschied ist eher der, dass die Unterrichtszeit der praktischen Fächer an der Hochschule geringer ist und von den Studierenden mehr erwartet wird, das Wissen im Selbststudium zu erlernen“, erklärt Physiotherapeutin Isabella Hotz vom Netzwerk „HochschuleJetzt!“. Und auch die staatlichen Abschlussprüfungen müssten die Absolventen der Studiengänge in gleicher Weise bestehen wie ihre Kollegen aus den Berufsfachschulen, betont das Bündnis „Therapieberufe an die Hochschulen“.
Internationale Vergleichbarkeit durch eine einheitliche Ausbildung
Laut des Bündnisses „Therapieberufe an die Hochschulen“ sei Deutschland das einzige Land, in dem Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie sowohl an Hochschulen als auch an Berufsschulen ausgebildet werden. „Im europäischen Ausland und weltweit findet die Ausbildung der Therapieberufe seit Jahren an Hochschulen statt“, schreibt das Bündnis. Außerdem sind die Abschlüsse unterschiedlich: Bei der Berufsfachschulausbildung gibt es einen Abschluss, der nach dem Europäischen Qualifikationsrahmen Niveaustufe 4 hat, während eine Bachelorstudium Niveaustufe 6 bringt. Zwar gibt es eine EU-Anerkennungsrichtlinie, um ausländische Therapeuten in Deutschland und deutsche Therapeuten im Ausland anerkennen zu lassen, aber diese muss immer individuell geprüft werden.
Für die Befürworter der Vollakademisierung liegt die Lösung in der ausschließlich hochschulischen Ausbildung. Der Wunsch, Therapieberufe international besser vergleichen zu können, hat nicht nur rein berufliche Gründe: Auch mit Blick auf internationale Vergleichbarkeit von Studien und Forschungen wäre laut den Befürwortern der Vollakademisierung eine rein hochschulische Ausbildung erstrebenswert.

„Und die Vollakademisierung ist notwendig, weil angesichts sich ändernder Bedarfe auch zukünftig alle Patienten ein Recht auf eine Therapie auf dem höchsten Stand der Wissenschaft und Praxis haben.“
Bernhard Borgetto
Bündnis „Therapieberufe an die Hochschulen“
Das komplette Interview:
Argumente für die Teilakademisierung der Therapieberufe
Die Gegenseite der Vollakademisierung will weiterhin die klassische berufsfachschulische Ausbildung erhalten – und doch zusätzlich die Möglichkeit anbieten, Therapieberufe an Hochschulen zu erlernen. Viele der Argumente, die für die Akademisierung sprechen, werden auch von den Befürwortern der Teilakademisierung unterschrieben (beispielsweise was die vermehrte Forschung im Heilmittelbereich betrifft). Aber die Meinung geht an der Stelle auseinander, wenn es darum geht, ob man ausschließlich hochschulisch ausbilden soll.
Die Teilakademisierung ist derzeit Standard, mit dem Unterschied, dass die Therapiestudiengänge aktuell immer noch Modellstudiengänge sind. „Um das Nebeneinander von fachschulischer und akademischer Ausbildung sinnvoll und reibungslos auszugestalten, sollten die Zuständigkeiten und Kompetenzen eindeutig definiert werden“, sagt die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG).
Bewährte Ausbildungsform
Die klassische berufsschulische Ausbildung von Therapieberufen hat sich nach Ansicht des Privatschulverbands und anderer Befürworter der Teilakademisierung bewährt. „Wir brauchen uns da nicht verstecken“, sagt z. B. Wolfgang Oster vom VDB-Physiotherapieverband. Und Bernd Dietrich von der Allianz für Gesundheitsschulen erklärt, „dass unsere Absolventen von den Berufsfachschulen gefragt sind.“ Laut Dietrich und Oster nicht nur in Deutschland, sondern auch über den Landesgrenzen hinaus.
Während die berufsschulische Ausbildung sich bewährt hat, sind die Verfechter der Teilakademisierung unsicher, ob die ausschließlich hochschulische Ausbildung Erfolg haben kann. „Denkbar ist alles, aber es ist eben auch nur eine Vermutung. Es ist unklar, ob eine Vollakademisierung erfolgreich sein wird oder nicht“, so Dietrich. Selbst wenn Studien den Erfolg der Modellstudiengänge bestätigen können, so kann doch niemand voraussehen, was wäre, wenn es nur noch die hochschulische Ausbildung geben sollte.
Nichtdestotrotz wissen alle Befürworter der Teilakademisierung, dass sich nicht auf dem Erfolg der berufsfachschulischen Ausbildung ausgeruht werden sollte. Eine Reformierung der veralteten Berufsgesetze wird von allen dringend gefordert.

Akademisierung von 10 bis 20 Prozent aller Therapieberufe soll ausreichen
Eine Quote, die immer wieder genannte wird, sind 10 bis 20 Prozent. Dieser Teil eines Ausbildungsjahrgangs der Therapieberufe soll akademisch ausgebildet werden – nicht wie von den Verfechtern der Vollakademisierung ganze 100 Prozent. Definiert wurde die Quote 2012 vom Wissenschaftsrat. Dieser war damals der Auffassung, „dass eine hochschulische Ausbildung nicht für alle Angehörigen der Gesundheitsfachberufe erforderlich ist und auch in Zukunft voraussichtlich nicht erforderlich sein wird.“
Unter anderem argumentieren die Befürworter der Teilakademisierung, dass die meisten Therapiepraxen nicht das Knowhow benötigen würden, das insbesondere an Hochschulen gelehrt wird. Laut Wolfgang Oster vom VDB-Physiotherapieverband dürfe das wissenschaftliche Evaluieren nicht die Bedeutung bekommen wie die eigentliche berufliche Tätigkeit der Physiotherapie. „Für über 80 Prozent der Physiotherapeuten geht es in den niedergelassenen Praxen darum, dass sie Patienten versorgen und bekommen auch nur das vergütet“, so Oster. „Was nützt es mir, wenn ich eine Praxis mit einem festen Patientenstamm habe und wenn ich in meiner Freizeit zusätzlich evaluiere und dokumentiere? Das passt nicht zum Vergütungssystem unseres Gesundheitssystems.“
Ein weiteres Argument gegen die Vollakademisierung ist, dass es schon so nicht gerade einfach ist, Menschen dazu zu bewegen, ein Therapieberuf zu studieren anstatt klassisch in der Berufsfachschule zu erlernen. Laut des Deutschen Verbands für Physiotherapie (ZVK) – übrigens einem Befürworter der Vollakademisierung – bestand der Akademisierungsanteil unter allen Auszubildenden der Physiotherapie 2017/2018 etwa 10 Prozent. Zudem sei es laut der DKG höchst fraglich, inwiefern es kurz- bis mittelfristig überhaupt gelingen sollte, entsprechende akademische Ausbildungskapazitäten zu schaffen.
Extraleistungen auch extra vergüten
Debattiert wird auch, wie im Falle einer Vollakademisierung die Finanzierung ausfallen wird. Soll das „Mehr“, was Hochschulabsolventen in den therapeutischen Alltag einbringen, auch entsprechend „mehr“ vergütet werden? Alle sind sich der Meinung, dass das so ein soll. Beispielsweise sagt auch die DKG, dass eine verbesserte Versorgungsqualität auch honoriert und besser vergütet werden soll. Aber woher das Geld nehmen, falls die Vollakademisierung Standard wird? Die Vergütung ist also ein weiteres Argument für die Teilakademisierung. Grundsätzlich sollen und müssen alle, die im Gesundheitsbereich arbeiten, besser vergütet werden als es bisher ist. Aber zusätzlich dürfen und sollen Extraleistungen auch entsprechend honoriert werden.
Weiterhin die Einstiegshürden in die Therapieberufe niedrig halten
Die Voraussetzungen, sich als Therapeut ausbilden zu lassen, sind an Berufsfachschulen niedriger als an einer Hochschule. Für letztere ist ein (Fach-)Abitur oder eine vergleichbare Qualifikation (beispielsweise durch eine vorherige Ausbildung) notwendig. Bei der Berufsfachschulausbildung reicht ein mittlerer oder gar geringerer Schulabschluss. Mit Blick auf den Fachkräftemangel ist es für die Befürworter der Teilakademisierung unerlässlich, das so zu belassen. Denn laut des Privatschulverbands würden in etwa 60 Prozent der Auszubildenden mit einer mittleren Reife starten. „Durch die Vollakademisierung werden junge Menschen ohne (Fach-)Hochschulzugangsberechtigung vom Zugang in die Ausbildung ausgeschlossen“, sagt der Privatschulverband. „Es bestünde damit die Gefahr einer Fachkräfteverknappung in diesem Bereich“, ergänzt die DKG in ihrer Stellungnahme, „eine Vollakademisierung würde den bestehenden Personalmangel weiter verstärken.“
Auf der anderen Seite sollen Studiengänge dazu einladen, sich von Vornherein oder auch im Laufe des Berufslebens akademisch ausbilden zu lassen. Wer aus seinem Therapieberuf mehr herausholen möchte, kann sich beispielsweise fort- bzw. weiterbilden lassen. Auch jene, die in den Beruf mit einem geringeren Schulabschluss gestartet haben, hätten somit die Chance, später zu studieren.

„Wir wissen, dass die berufsfachschulische Ausbildung ein Erfolgsmodell ist, dass sie eine große Beliebtheit hat und dass sie beim Arbeitgeber ankommen.“
Bernd Dietrich
Sprecher der Allianz für Gesundheitsschulen, einer Initiative des Verbands Deutscher Privatschulverbände (VDP)