- Lösungen
- Für wen
- Preise
- Wissen
- Über uns
Heilmittel
Die Vollakademisierung: Therapieberufe nur noch hochschulisch ausbilden?
Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie komplett hochschulisch erlernen – und das für alle Auszubildenden: Das fordern die Verfechter der Vollakademisierung für Therapieberufe. Die klassische Ausbildung per Berufsfachschule soll schrittweise der rein akademischen Ausbildung weichen. Der Hochschulverbund Gesundheitsfachberufe (HVG) empfiehlt hierfür ein Übergangszeitraum von 10 bis 15 Jahren. Zusammen mit mehreren Berufsverbänden bildet er das Bündnis „Therapieberufe an die Hochschule“. Dessen Meinung: „Das wesentliche Element der Modernisierung besteht nach Auffassung des Bündnisses in einer Reform der Ausbildungsstruktur, die eine vollständige hochschulische Qualifikation, also einen primärqualifizierenden Bachelorstudiengang als Regelausbildung vorsieht.“
Immerhin besteht seit 2009 durch die Modellstudiengänge die Möglichkeit Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie zu studieren. Die Resonanz ist derzeit aber noch etwas schleppend: Von allen Auszubildenden im Bereich Physiotherapie entscheiden sich laut des Deutschen Verbands für Physiotherapie (ZVK) nur jede:r Zehnte für eine hochschulische Ausbildung. Und von sämtlichen aktiven Physiotherapeut:innen in Deutschland (203.000) hätten nicht einmal 1 Prozent (2.000) einen Hochschulabschluss. Die aktuellen Zahlen sind also noch eher ernüchternd – und dennoch spricht so manches für eine Vollakademisierung.
Sinn oder Unsinn der hochschulischen Ausbildung von Therapieberufen
Zunächst lohnt es sich, einmal die Vorteile der Akademisierung im Bereich der Therapieberufe an sich zu nennen. Denn im Grunde lehnt niemand eine hochschulische Ausbildung für den Heilmittelbereich ab, nur geht halt die Meinung auseinander, ob diese ausschließlich (Vollakademisierung) oder aber parallel zur berufsfachschulischen Ausbildung angeboten werden soll (Teilakademisierung). „Das zentrale Ziel der Ausbildungsreform, die Befähigung klinischer Praktiker:innen zu evidenzbasiertem Entscheiden und Handeln in der individuellen und interprofessionellen Patient:innenversorgung, ist nur durch die hochschulische Ausbildung zu erreichen“, nennt das Bündnis „Therapieberufe an die Hochschule“. Unter dem hierzu oft genannten Begriff „evidenzbasiert“ verstehen wir das Arbeiten auf der Basis empirisch zusammengetragener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Natürlich stellt sich dabei grundsätzlich die Frage, warum evidenzbasiertes Entscheiden und Handeln „nur durch die hochschulische Ausbildung zu erreichen“ sei. Dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse akademisch gewonnen werden, ist nahelegend – aber lassen sich die gewonnenen Erkenntnisse nicht auch gut in einer klassischen Ausbildung vermitteln?
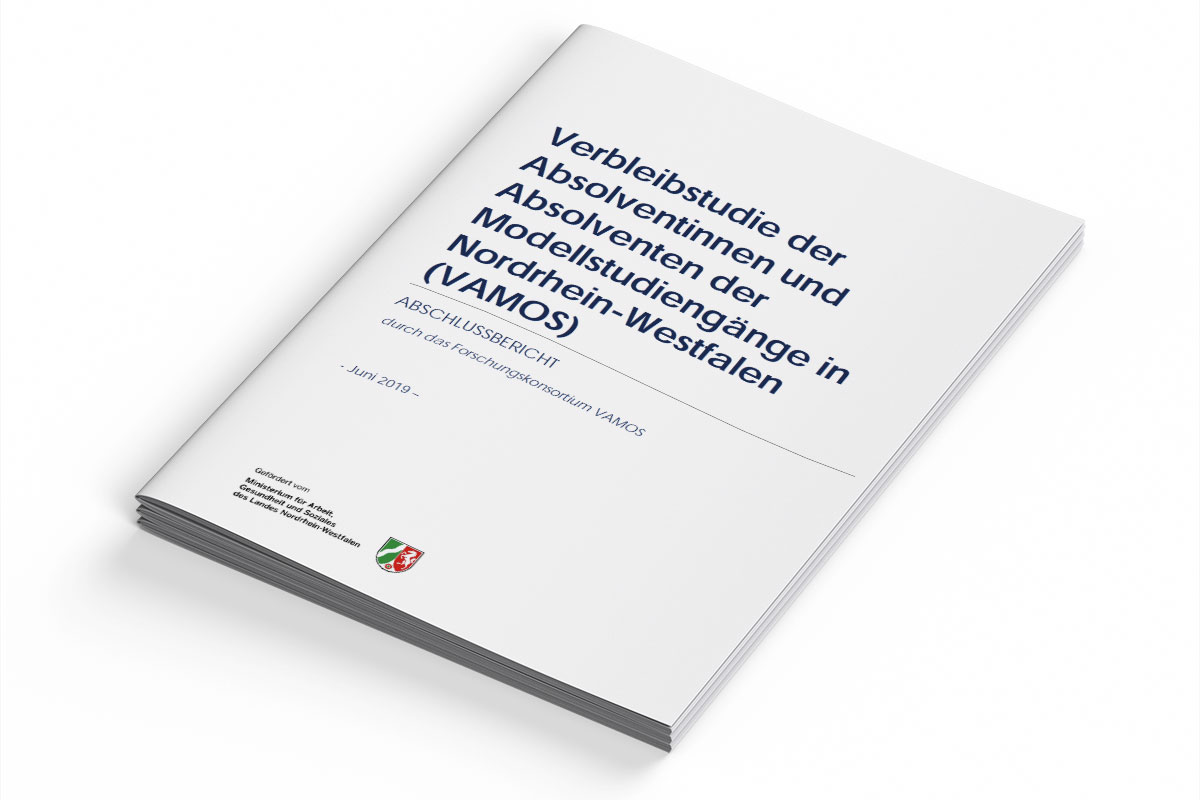
Ein Blick in die Praxis: Bei der 2019 veröffentlichten Studie „Vamos“ wurden unter anderem Arbeitgeber:innen befragt, die akademisch ausgebildete Heilmittelerbringer:innen angestellt haben. Die Arbeitgeber:innen nahmen im Vergleich zu berufsfachschulisch gelernten Therapeut:innen einen gewissen Mehrwert bei den Akademiker:innen wahr. „Dieser zeigt sich am deutlichsten beim „Recherchieren, Bewerten und Kommunizieren wissenschaftlicher Erkenntnisse“ (91 Prozent), beim „Planen, Steuern und Evaluieren von therapeutischen, pflegerischen bzw. hebammenkundlichen Prozessen“ (74 Prozent) sowie bei der „Qualitätssicherung und -entwicklung“ (70 Prozent).“ Das spricht also definitiv für die hochschulische Ausbildung.
Mehr Forschungsimpulse und neue Kernaufgaben
Evidenzbasiert heißt vor allem, dass mehr Forschung rund um die Heilmittel durchgeführt werden. „Eine zukunftsfähige Patientenversorgung braucht (…) ergotherapeutische, logopädische/sprachtherapeutische und physiotherapeutische Forschung an Fachhochschulen und Universitäten“, so der HVG in einer Stellungnahme von 2020. Das Bündnis „Therapieberufe an die Hochschule“ ergänzt dazu in einem FAQ: „Aufgrund der fehlenden akademischen Anbindung gingen bisher nur geringe Forschungsimpulse von Deutschland aus. Bereits 2012 forderte der Gesundheitsforschungsrat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, dass den Therapieberufen eine auf den eigenen Beruf bezogene Forschung ermöglicht werden müsse und diese auf europäischer und internationaler Ebene zu vertiefen sei.“ Mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die die Forschung hervorbringt, lassen sich demnach Kompetenzen entwickeln, die „eine kritische Auseinandersetzung mit Versorgungskonzepten und eine evidenzbasierte Praxis ermöglichen“, so das Bündnis.
Natürlich stellt sich die Frage, ob es denn notwendig ist, dass alle zukünftigen Therapeuten solche Kompetenzen benötigen. Beispielsweise betont das Bündnis in seinem FAQ, dass Vorwürfe gegen eine Vollakademisierung in anderen Berufsbereichen – z. B. in technischen Berufen – nicht zu hören seien. Und dennoch: In technischen Berufen gibt es sowohl jene, die eine klassische Berufsausbildung absolviert haben (z. B. Elektrotechniker) als auch jene, die an einer Hochschule ein Ingenieursstudium durchgeführt haben. Sollen Heilmittelpraxen ausschließlich – rein bildlich gesprochen – „Ingenieure“ anstellen? Müssen sämtliche Therapeut:innen die Kompetenzen haben, die eine hochschulische Ausbildung vermittelt? Oder ist die hochschulische Therapeut:innenausbildung nicht eher etwas für jene, die beispielsweise die Praxisleitung übernehmen?
Für das Bündnis „Therapieberufe an die Hochschule“ jedenfalls zählt ein solches Kompetenzniveau zu den Kernaufgaben der Therapieberufe – also nicht nur für die Praxisleistung. „Die Therapie ist ein fortlaufender und vor allem interaktiver Prozess“, sagt Prof. Dr. Borgetto vom Bündnis. „Informationsaufnahme, Befund, Behandlung und fortlaufende Entscheidungsfindung zur möglichen Anpassung der therapeutischen Maßnahmen müssen aus einer Hand kommen, um das bestmögliche Therapieergebnis zu erzielen. Gerade die Reaktionen auf die Behandlung von Patient:innen im Laufe einer Therapiesitzung verschaffen Erkenntnisse, die wiederum vor dem Stand des verinnerlichten wissenschaftlichen Wissens reflektiert werden und in fortlaufende Entscheidungen einfließen.“ Nach Borgettos Auffassung sei es nicht praktikabel, mehrere Entscheidungen in einer Behandlungseinheit mit der Leitung einer Praxis anzusprechen. „Jede:r Therapeut:in soll den jeweils eigenen Wissensstand kontinuierlich weiterentwickeln können“, so Borgetto. (Das gesamte Interview, das wir mit Prof. Dr. Borgetto führten, gibt es demnächst hier im neuen DMRZ.de-Blog!)
Die „Unteilbarkeit der Berufe“
Aus solchen Gründen sei auch aus Sicht des gesamten Bündnisses „Therapieberufe an die Hochschule“ eine „Unteilbarkeit der Berufe“ entscheidend. „Die Fortsetzung bzw. der Ausbau der bestehenden Teilakademisierung sind keine Lösung. Das Nebeneinander von hochschulischer und berufsfachschulischer Ausbildung ist weder fachlich begründbar noch ökonomisch zu vertreten“, steht im FAQ des Bündnisses geschrieben.
Grund für ein Umdenken ist das Aufkommen neuer Herausforderungen der Patient:innenversorgung. „Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, des Fortschreitens des medizinisch- technischen Fortschritts und des sich wandelnden Tätigkeitsspektrums werden sich die Qualifizierungsbedarfe in den Therapieberufen deutlich verändern“, erklärt das Bündnis. Beispielsweise müssten Therapien und Beratungen zukünftig weit mehr individuell geplant, angewendet und evaluiert werden als heute.

Die Schlüsselqualifikationen der Absolvent:innen
Aktuell jedenfalls ist die gewünschte „Unteilbarkeit der Berufe“ noch Zukunftsmusik. Die Gruppe der Therapeut:innen teilt sich derzeit noch in zwei Klassen. „Die Absolvent:innen übernehmen im Vergleich zu fachschulisch ausgebildeten Kolleg:innen besondere Aufgaben vor allem in den Bereichen Beratung, interprofessionelle Zusammenarbeit, Projektarbeit, wissenschaftliche Recherche, Konzeptentwicklung sowie als Expert:innen die Verantwortung spezifischer fachlicher Themen“, so die Vamos-Studie.
Doch was genau sind denn die Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen, die über eine hochschulische Ausbildung vermittelt werden und die laut des Bündnisses „durch die (berufs-)fachschulische Ausbildung nicht hinreichend vermittelt werden können“? Das Bündnis nennt in seinem FAQ mehrere Abschlusskompetenzen, die eine Evaluation der Modellstudiengänge in Nordrhein-Westfalen ermittelt haben:
Befähigung zu einem reflektierten, kritisch-konstruktiven Diskurs und wissenschaftsbasiertem professionellen Handeln in Diagnostik und Intervention
Entwicklung des hermeneutischen Fallverstehens, um bedarfs- und bedürfnisgerecht handeln zu können
Befähigung zur Anwendung wissenschaftlichen Wissens auf dem jeweils aktuellen Entwicklungsstand
Klinische Kompetenzen auf Bachelorniveau
Befähigung zur (sektorenübergreifenden) Fallsteuerung
Befähigung zum Aufbau und zur Reflexion eines Arbeitsbündnisses
Befähigung zur Zusammenarbeit mit anderen Professionen und zur Förderung der Kooperation
Fähigkeit zur Förderung/Weiterentwicklung der Profession
Nah an der:dem Patient:in
Vor allem darf auch bei der hochschulischen Ausbildung die Praxis nicht fehlen. „Eine hochschulische Ausbildung in den Therapieberufen umfasst sowohl fachpraktische als auch wissenschaftlich-fachliche Anteile. Der fachpraktische Anteil fällt nicht hinter den der (bisherigen) berufsfachschulischen Ausbildung zurück“, urteilt das Bündnis. „Die Absolvent:innen der Modellstudiengänge müssen also die praktischen staatlichen Prüfungen in gleicher Weise bestehen wie ihre Kolleg:innen aus den Berufsfachschulen.“ Auch die Befragung von Absolvent:innen belegt, dass die Arbeit direkt an der:dem Patient:in ausschlaggebend ist. Laut der Vamos-Studie ist bei 87 Prozent der befragten Absolvent:innen der Physiotherapie und Logopädie und 93 Prozent Absolvent:innen der Ergotherapie der Arbeit von Klienten nahen Aufgaben geprägt.
Das Bündnis urteilt: „Ein primärqualifizierendes Studium stellt die Ausbildung vom ersten Tag an auf ein wissenschaftliches Fundament und bis zum Bachelor-Abschluss unter die Verantwortung der Hochschule – sowohl im theoretischen wie auch im praktischen Ausbildungsteil. Dadurch wird die Grundlage für ein einheitliches akademisches Profil des jeweiligen Berufes gelegt.“
Vor allem ist es wichtig, dass die Berufe im Heilmittelbereich attraktiver werden – umso dem Fachkräftemangel Einhalt zu gebieten. Beispielsweise macht eine Vollakademisierung es einfacher, auch international zu arbeiten. Oder es könnte laut der Studierendeninitiative „HochschuleJetzt!“ die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen stärken. „Bessere interprofessionelle Zusammenarbeit setzt eine Bewegung über effektivere und effizientere Patient:innen-Versorgung bis hin zu mehr gesellschaftlicher Wertschätzung und Attraktivität der Therapieberufe in Gang.“
Schlechtere Einstiegsvoraussetzungen?
Auch wenn vieles für die Vollakademisierung spricht, gibt es dennoch ein paar Kritikpunkte mit Hinblick auf die Abschaffung der berufsfachschulischen Ausbildung. Vor allem sind die Ausbildungsqualifikationen bei letzterem breiter aufgestellt als bei einem Studium. Zwar beteuert das Bündnis „Therapieberufe an die Hochschule“, dass auch ohne Abitur Therapieberufe studiert werden können (z. B. wenn Interessent:innen bereits eine entsprechende Berufserfahrung mitbrächten). Für Prof. Dr. Borgetto vom Bündnis erklärt im DMRZ.de-Interview, dass Studien belegen würden, dass junge Menschen, die über eine Hochschulzugangsberechtigung verfügen, in der Regel auch studieren möchten. „Wir gehen daher davon aus, dass der Effekt der Attraktivitätssteigerung für die Schulabsolvent:innen mit Hochschulzugangsberechtigung sich in der Summe positiv auf den Fachkräftemangel auswirkt, ihn also reduzieren wird.“
Demnächst im DMRZ.de-Blog: Das gesamte Interview mit Prof. Dr. Borgetto über das Thema Vollakademisierung!
Weitere Artikel zum Fachkräftemangel und zur Ausbildung im Heilmittelbereich
- Die fehlende Attraktivität bei Therapieberufen
- Die Modellstudiengänge für die Therapieberufe
- Die Ausbildung von Therapieberufen im Ausland
- Die Teilakademisierung: Therapieberufe weiterhin an Berufsfachschulen ausbilden?
- Interview mit Wolfgang Oster (VDB-Physiotherapieverband) zur Teilakademisierung: Teil 1 und Teil 2
Die Vollakademisierung: Therapieberufe nur noch hochschulisch ausbilden?
Interview mit Bernhard Borgetto (Bündnis Therapieberufe) zur Vollakademisierung: Teil 1, Teil 2 und Teil 3
Interview mit Isabella Hotz (HochschuleJetzt!) über die Hochschulausbildung von Therapieberufen
Strategiepapier: Wie die Vollakademisierung von Therapieberufen aussieht

