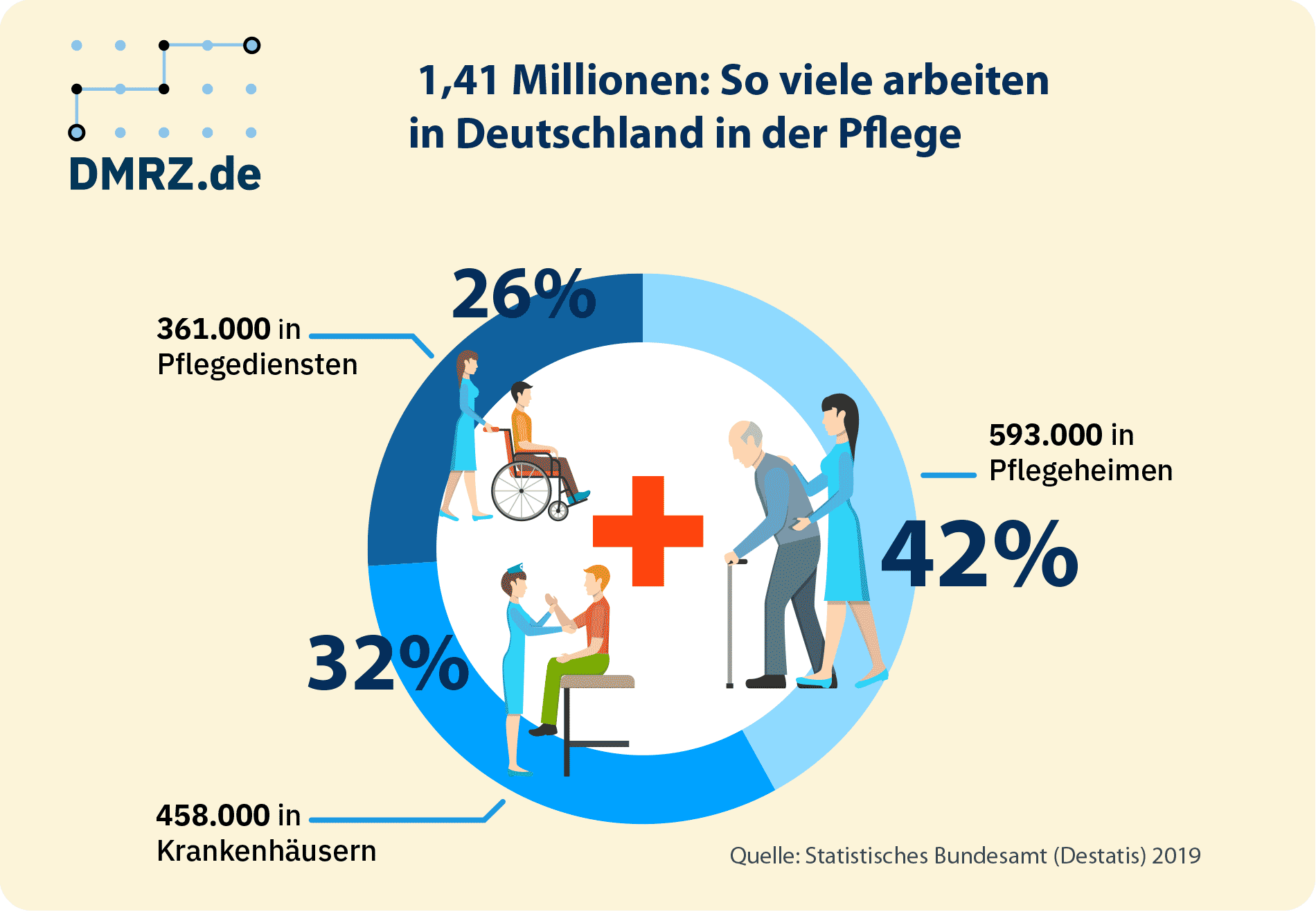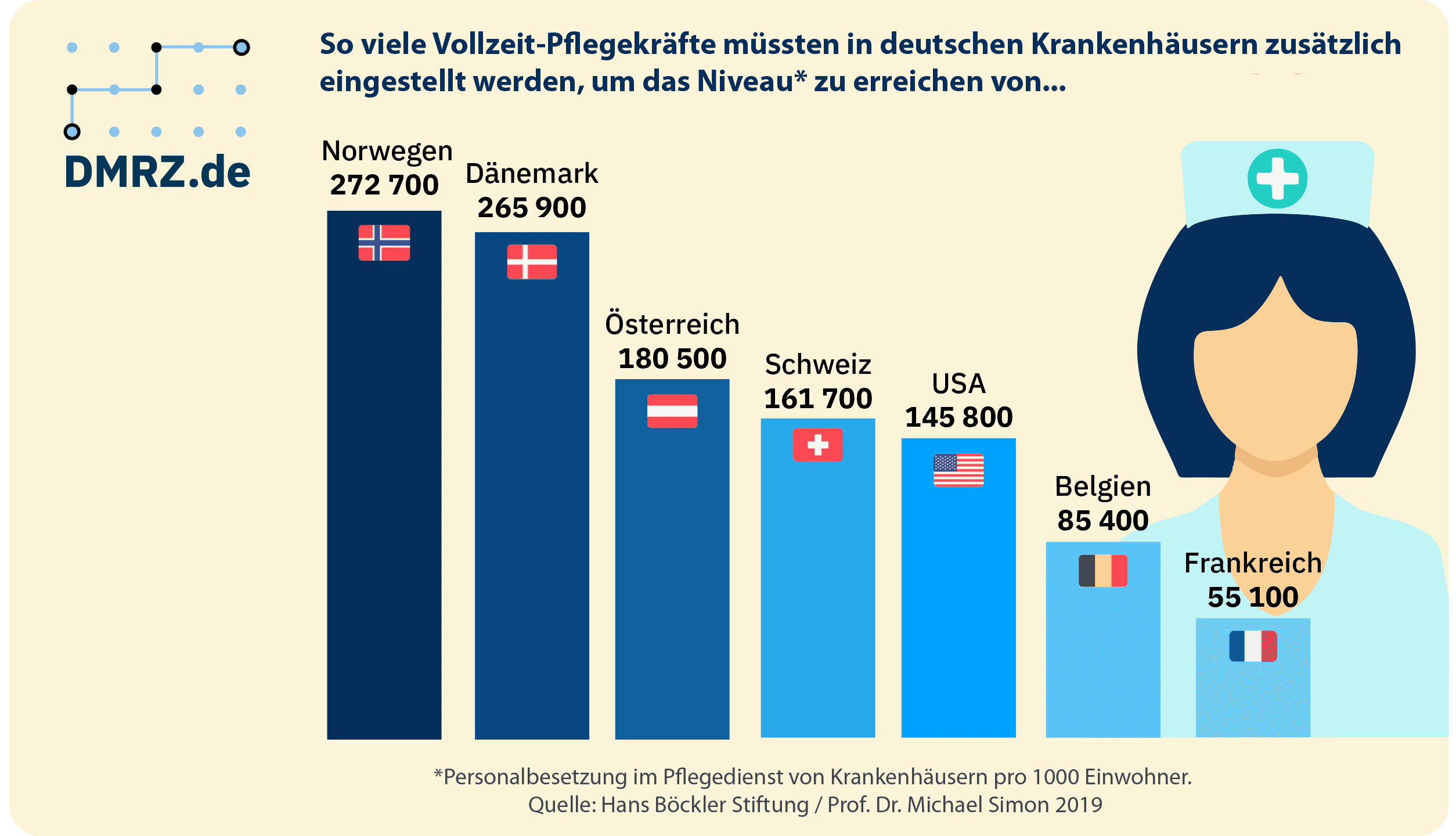- Lösungen
- Für wen
- Preise
- Wissen
- Über uns
Pflege
Was ich in der Pflege verdiene (1) Die Herausforderungen einer Branche
Vielleicht spielst Du ja mit dem Gedanken, in der Pflege zu arbeiten. Als Krankenfachpfleger:in oder als Altenpfleger:in, als ungelernte:r Quereinsteiger:in oder über den Weg einer Ausbildung oder eines Studiums. Und wie bei jeder anderen Berufswahl stellt sich auch hier die Frage nach dem Lohn. Was genau Du in der Pflege verdienen kannst, lässt sich nicht in einem Satz sagen: Zu groß ist die Bandbreite der beruflichen Möglichkeiten und zu groß sind die unbeeinflussbaren Faktoren, die sich in Deinem zukünftigen Gehalt widerspiegeln. In dieser Beitragsserie wollen wir die Pflegebranche auf ihre Verdienstmöglichkeiten untersuchen.
Der Bezahlung in der Pflege: Viel zu wenig?
Bei der Berufswahl sollte jeder aber auch die allgemeine Meinung und Stimmung nicht außer Acht lassen. Beispielsweise hat eine Auswertung eines Mitarbeiters des Instituts Arbeit und Qualifikation an der Uni Duisburg-Essen ergeben, dass sich eine große Zahl der Krankenpfleger:innen ungerecht bezahlt fühlt. Ein solches Empfinden gibt es in vielen Berufen – fast jede:r Zweite (48,6 Prozent) findet den Verdienst als ungerechterweise zu niedrig. Doch im Vergleich dazu sind es fast Zweidrittel der Krankenpflegekräfte (64,6 Prozent), die das so sehen.
Zusätzlich hat eine von der Hans Böckler Stiftung beauftragte repräsentative Umfrage zu Beginn der Corona-Pandemie ergeben: 94 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland sind der Meinung, dass die systemrelevanten Berufe weit besser bezahlt werden müssten.
So viel zu den Meinungen. Aber ist die Kritik auch gerechtfertigt?
Finanzielle Ungerechtigkeit – am Beispiel der Gender-Pay-Gap
Das Thema Verdienst lässt sich wie gesagt nicht in einem Satz abhaken. Und es gibt zu viele Faktoren, die sich positiv wie negativ auf die Bezahlung auswirken. Ein gutes Beispiel, das jedoch eine finanzielle Ungerechtigkeit gut verdeutlicht, ist die Gender-Pay-Gap. Dieser Begriff bezeichnet den Unterschied des durchschnittlichen Bruttostundenlohns von Männern und Frauen. Denn laut des Karriereportals Medi-Karriere würden Frauen in der Pflege oft weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Am stärksten sei das in Krankenhäusern, wo durchschnittlich bis zu 31 Prozent weniger verdient wird. (In einem der kommenden Beiträge unserer großen Pflege-Serie werden wir diese Zahlen ausführlicher vorstellen.)
Laut des Statistischen Bundesamts (Destatis) wären 71 Prozent des Verdienstunterschieds zwischen Männern und Frauen strukturbedingt erklärbar. Die Fachzeitschrift „Altenheim“ erklärt, dieser „strukturbedingte“ Verdienstunterschied läge daran, „dass Frauen häufiger in Branchen und Berufen arbeiten, in denen schlechter bezahlt wird und sie seltener Führungspositionen erreichen. Auch arbeiten sie häufiger als Männer in Teilzeit und in Minijobs und verdienen deshalb im Durchschnitt pro Stunde weniger.“ Etwa zwei von drei Frauen, die in Pflegeheimen oder Pflegediensten tätig sind (65 %), arbeiten in Teilzeit (Quelle: Destatis).
„Erschwerend hinzu kommt natürlich auch, dass Frauen immer wieder den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit (wie z. B. für Kinder und Angehörige) übernehmen“, erklärt Johanna Moiseiwitsch von der Fachzeitschrift „Rechtsdepesche für das Gesundheitswesen“. Ein weiterer Faktor der Gender-Pay-Gap sei die Tatsache, dass Frauen in Führungspositionen stark unterrepräsentiert sind. In den Krankenhäusern NRWs beispielsweise wären nur 57 Prozent der Führungskräfte weiblich. Klingt nach „überdurchschnittlich“ – ist es aber nicht! Die Quote der Führungskräfte klingt eher wie Hohn, wenn man bedenkt, wie groß der Frauenanteil in der Pflege an sich ist. 85 Prozent des Pflege- und Betreuungspersonals in Heimen und ambulanten Diensten sind laut Destatis weiblich. Also ein frauendominierte Branche – aber mit geringer Frauenquote in der Führungsebene und mit hoher Gender-Pay-Gap. An diesem Bespiel erkennenwir schnell, dass in der Pflegebranche etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.
Schlechte Bezahlung – nicht nur für die Frauen
Wer übrigens meint, dass dieses Beispiel ja ein rein „weibliches Problem“ ist, irrt sich. Eine hohe Gender-Pay-Gap bedeutet nicht automatisch, dass männliche Pflegekräfte weit besser dastehen. Denn die negative Dynamik beeinflusst die gesamte Branche – unabhängig vom Geschlecht. Beispielsweise ist die überdurchschnittlich hohe Teilzeitquote auch bei Männern in der Pflege zu sehen; laut Destatis arbeiten 44 Prozent der männlichen Altenpfleger in Teilzeit.
Patricia Drube von der Bundespflegekammer urteilt: „Leider ist es so, dass in frauendominierten Berufen nicht nur die Frauen vergleichsweise schlecht bezahlt werden, sondern auch die Männer.“
Fachkräftemangel – „schon vor der Corona-Krise“!
Nun ist es aber so, dass der Lohn allein nicht ausreicht, sich für oder gegen einen Job zu entscheiden. Auch die Bedingungen müssen stimmen! Zwar waren 1,41 Millionen Menschen 2019 in Deutschland mit der Pflege, Betreuung oder Unterstützung Pflegebedürftiger beschäftigt – und doch sagt Destatis in einer Pressemeldung: „Schon vor der Corona-Krise herrschte ein Mangel an Pflegekräften in Deutschland.“
(Die folgende Grafik basiert auf Daten dieser Quelle.)
Der Gesundheitssystemforschers Prof. Dr. Michael Simon schätzt, dass zum Beispiel in deutschen Krankenhäusern gut 100.000 Vollzeitstellen für Pflegerinnen und Pfleger fehlen. Und der Blick ins Ausland? Auf Basis der Anzahl an Pflegekräften pro 1.000 Einwohner sind beispielsweise rund 162.000 zusätzliche Vollzeitkräfte notwendig, um einen vergleichbaren Stand wie die Schweiz zu haben. Oder fast 266.000, um mit Dänemark gleichauf zu sein. (Die folgende Grafik basiert auf Daten dieser Quelle.)
„Pflegekräfte wollen gute Arbeit machen und können das nicht“
Ein hoher Bedarf an Fachkräften lässt vielleicht hoffen, dass die Arbeitgeber, Krankenkassen und Gesetzgeber Neulinge mit tollen Tarifen und Arbeitsbedingungen locken. Aber so ist es leider nicht. „Der Personalmangel ist für die Beschäftigten seit langem ein drängendes Problem. Pflegekräfte wollen gute Arbeit machen und können das nicht, wenn die Personalbemessung nicht stimmt“, erklärt Dorothea Voss von der Hans Böckler Stiftung. „Derzeit führt die Kombination aus Personalmangel und unzureichender Entlohnung dazu, dass zu viele Pflegekräfte wegen der Arbeitsbedingungen aussteigen.“
Die Belastungen in der Pflegebranche sind nicht zu unterschätzen: Während nur jede siebte erwerbstätige Person in Deutschland (14 %) Schichtdienst hat, trifft dies auf etwa 60Prozent Krankenpfleger:innen und auf 57 Prozent der Altenpfleger:innen zu. Rund jede:r dritte Erwerbstätige muss in Deutschland am Wochenende arbeiten – in der Kranken- und Altenpflege jedoch 74 Prozent bzw. 79 Prozent (Quelle Destatis). Und je nach Höhe der Inzidenzzahlen und Hospitalisierungen während der Corona-Pandemie dürfte die schon so hohe Belastung sogar noch drastischer ausfallen.
Gute Arbeitsbedingungen mindestens genauso wichtig wie der Lohn
Wer mit dem Gedanken spielt, in der Pflege zu arbeiten, sollte die Entscheidung also nicht nur mit Blick aufs Geld treffen. „Für viele Pflegekräfte sind beispielsweise verlässliche Arbeitszeiten, eine ausreichende Personalausstattung und weniger Zeitdruck – also gute Arbeitsbedingungen – mindestens genauso wichtige, wenn nicht wichtigere Themen“, heißt es in einem Beitrag über „Löhne in der Altenpflege“ des Instituts Arbeit und Technik der Westfälischen Hochschule und der Ruhr-Universität Bochum (PDF). Höhere Verdienste sollen also nur als ein Baustein für die Aufwertung der Pflegearbeit dienen – und nicht als alleiniger Gegenstand von Tarifverträgen.
„Bessere Arbeitsbedingungen und eine fairere Bezahlung könnten auch mehr potenzielle Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen motivieren, in der Pflege zu arbeiten“, hofft die Hans Böckler Stiftung. Dies könne helfen, die vielen unbesetzten Stellen schneller zu füllen. Laut einer Studie der Stiftung würden Arbeitgeber:innen in der Pflegebranche Quereinsteiger:innen als eine große Bereicherung wahrnehmen.
Im nächsten Beitrag unserer großen Pflege-Serie „Was ich in der Pflege verdiene“ widmen wir uns konkret dem Thema Lohn. Wir zeigen Dir, welche Faktoren Dein zukünftiges Gehalt als Pflegekraft beeinflussen werden.