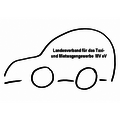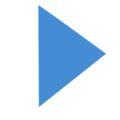- Online-Abrechnung
- Software
- Für wen
- Preise
- Wissen
Alles, was Sie zu Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) wissen sollten
Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA), auch „App auf Rezept“ genannt, sind Apps oder Webanwendungen, die vom Arzt oder Psychotherapeuten verschrieben werden können. Sie helfen bei bestimmten Erkrankungen ergänzend zur üblichen Behandlung.
Nur sorgfältig geprüfte Anwendungen dürfen als DiGA im DiGA-Verzeichnis aufgeführt werden. Voraussetzung ist, dass die Apps für die jeweils genannte Diagnose dem Patienten einen „positiven Versorgungseffekt“ bieten.
DiGA können beispielsweise gegen Symptome oder Beschwerden starker Krankheiten entgegenwirken, als Erinnerungshilfe dienen, Verhaltenstipps geben oder mit anderen Geräten – z. B. Insulinpens oder Fitnesstrackern – angebunden werden.
Erfahren Sie hier, worauf es bei DiGA ankommt und wie Sie diese beziehen können. Außerdem stellen wir Ihnen einige digitale Gesundheitsanwendungen genauer vor und erklären, was der Unterschied zu DiPA, digitale Pflegeanwendungen ist.
Inhaltsverzeichnis: Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) einfach erklärt
Was ist eine digitale Gesundheitsanwendung (DiGA)?
Digitale Gesundheitsanwendungen werden kurz auch DiGA oder auch „App auf Rezept“ genannt. DiGA sind also Anwendungen, die vom Arzt (oder alternativ Psychotherapeuten) genauso wie ein Medikament verordnet werden.
DiGA können sowohl Apps für mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets als auch browserbasierte Anwendungen sein. DiGA lassen sich über jeden Browser – egal, ob mobil oder am Computer – aufrufen und nutzen. Manche DiGA können auch in Kombination mit anderen Geräten – z. B. Pulsmessgeräten – oder anderer Software betrieben werden.
Digitale Gesundheitsanwendungen haben die Aufgabe, bei der Diagnosestellung einer Krankheit zu unterstützen und/ oder die Beschwerden oder Symptome von Erkrankungen, Verletzungen oder Behinderungen zu lindern. Apps auf Rezept können von Patienten allein genutzt werden oder aber in Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt. DiGA ergänzen oder unterstützen die medizinische Behandlung, sie ersetzen sie aber nicht. Die digitalen Gesundheitsanwendungen sind somit also kein Ersatz für Arztbesuche oder die Einnahme von Arzneimitteln.
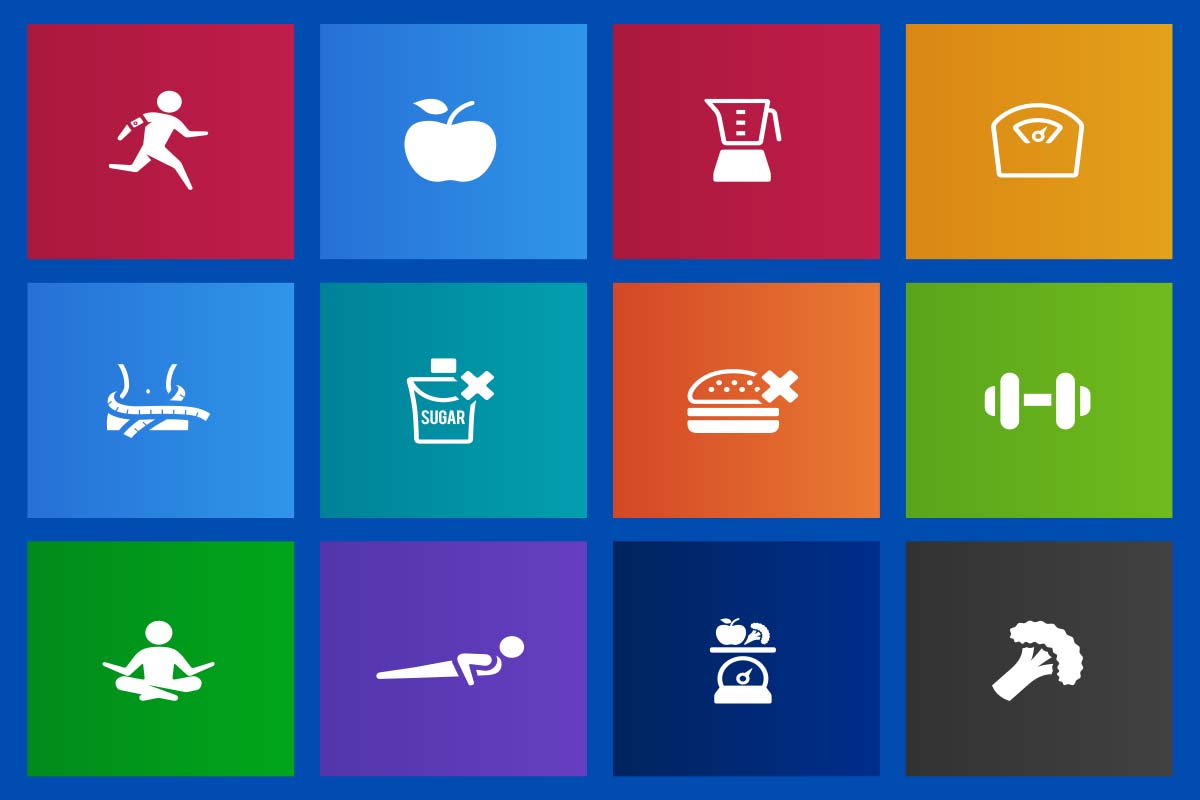
Der Unterschied von DiGA zu gewöhnlichen Gesundheits-Apps
In den Appstores von Google (Android) und Apple (iPhone/iPad) gibt es massenhaft Apps, die sich um das Thema Gesundheit drehen. Von diversen Fitness-Apps, Abnehm-Apps oder sonstigen Anwendungen, die sich mit Themen wie Gesundheit, Ernährung oder speziellen Krankheiten befassen, sind DiGA klar zu unterscheiden. Frei verfügbare Gesundheits-Apps sind nicht „auf Rezept“ erhältlich, werden also in der Regel nicht von der Krankenkasse oder Pflegeversicherung getragen und finanzieren sich hingegen über Abos, Käufe oder Werbung. Solche Apps sind nicht per se schlecht – sie haben nur nicht immer den medizinischen Anspruch einer offiziellen DiGA.
DiGA aber sind offizielle Medizinprodukte, wurden dementsprechend sorgfältig auf ihren medizinischen Nutzen geprüft und sind in der Regel verschreibungspflichtig. Die monatlichen Kosten für die Nutzung von digitalen Gesundheitsanwendungen trägt die Krankenkasse.
Im Unterschied zu einer gewöhnlich beziehbaren App muss eine DiGA so entwickelt worden sein, dass sie bei einer oder mehreren medizinischen Indikatoren angewendet werden können. Die Aussagen, bei welchen Krankheiten/ Beschwerden die DiGA helfen soll, muss klar benannt sein.
Die gesetzliche Regelung von digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA)
2019 wurden DiGA durch das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) etabliert. Sie sind also offizieller Bestandteil der deutschen Gesundheitsversorgung. Genau definiert sind die „Apps auf Rezept“ im fünften Sozialgesetzbuch (SGB V) sowie in der speziellen Digitale-Gesundheitsanwendungen-Verordnung (DiGAV, oder auch „Verordnung über das Verfahren und die Anforderungen der Prüfung der Erstattungsfähigkeit digitaler Gesundheitsanwendungen in der gesetzlichen Krankenversicherung“).
§ 33a SGB V erklärt:
„Versicherte haben Anspruch auf Versorgung mit Medizinprodukten niedriger Risikoklasse, deren Hauptfunktion wesentlich auf digitalen Technologien beruht und die dazu bestimmt sind, bei den Versicherten oder in der Versorgung durch Leistungserbringer die Erkennung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder die Erkennung, Behandlung, Linderung oder Kompensierung von Verletzungen oder Behinderungen zu unterstützen (digitale Gesundheitsanwendungen).“
Die „niedrige Risikoklasse“ wird im Gesetz ebenfalls genau definiert. Gemeint ist damit, dass DiGA als Medizinprodukte (und somit als Hilfsmittel) ausgewiesen sind, die dem Patienten unmittelbar zu Gute kommt und ein geringes Risiko (z. B. durch eine Fehlbedienung) besitzen. Damit unterscheiden sich DiGA beispielsweise von hoch komplizierten Geräten wie Herzschrittmachern oder Dialysegeräten.
§ 33a SGB V gibt zudem vor, dass DiGA vom behandelnden Arzt oder Psychotherapeuten verordnet werden müssen oder alternativ von der Krankenkasse genehmigt werden können. Gegenüber der Kasse muss der Patient nachweisen, dass die entsprechende medizinische Indikation auf ihn/ sie zutrifft.
Auch muss eine DiGA im „Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwendungen“ aufgeführt sein, um als solche verschrieben zu werden. Wir zeigen Ihnen im Anschluss, welche Anforderungen erfüllt sein müssen, um als App im DiGA-Verzeichnis aufgeführt zu werden.
So erhält eine App die Zulassung zur digitalen Gesundheitsanwendung (DiGA)
Im Vergleich zu gewöhnlichen Gesundheits-Apps müssen DiGA einen sogenannten „positiven Versorgungseffekt“ für Ihre individuelle Situation bieten. Ob dem so ist, entscheidet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM. Die Hersteller der DiGA reichen ihre Apps bzw. browserbasierten Anwendungen zur Überprüfung beim BfArM ein. Dieses checkt in einem Bewertungsverfahren, ob eine App in der Tat als offizielle DiGA betrieben werden darf und somit in dem DiGA-Verzeichnis aufgeführt werden darf. Nur dann lässt sich eine solche App auf Kosten der Krankenkasse verschreiben.
Die Anforderungen an DiGA wurden vom Gesetzgeber sowie den Krankenversicherungen genau definiert. Beispielshafte Kriterien sind:
Wurde die Anwendung als Medizinprodukt mit niedrigem Risiko CE-zertifiziert?
Werden alle notwendigen Anforderungen an Sicherheit und Leistungsfähigkeit, klinische Bewertung, Qualitätssicherung, Risikobewertung etc. erfüllt?
Wurden die medizinischen Indikatoren – also die entsprechenden ICD-10-Codes der jeweiligen Krankheit – klar bekannt?
Wird der gesetzliche Datenschutz gewährleistet?
Sind die Apps – im Falle von mobilen Anwendungen – über die üblichen Plattformen für Android- und/oder iOS-Apps zu beziehen?
Gibt es Belege (z. B. analytische Daten durch Studien) für den konkreten „positiven Versorgungseffekt“ bei den jeweils genannten Krankheiten?
Werden die Anwendungen ins DiGA-Verzeichnis eingeführt, erhalten Sie entweder direkt den Status „dauerhaft aufgenommen“ oder auch erst „vorläufig aufgenommen“. Letzteres geschieht, wenn nach Auffassung der BfArM noch nicht genug wissenschaftliche Erhebungen und Analysen vorliegen, die den positiven Versorgungseffekt für Patienten ausreichend nachweisen. In einer Probezeit von 12 bis 24 Monaten haben die Hersteller Zeit, diese Daten nachzuliefern.

Was macht eine gute DiGA aus?
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erklärt, was genau mit dem „positiven Versorgungseffekt“ gemeint ist: „Eine DiGA bietet einen positiven Versorgungseffekt, wenn sich der gesundheitliche Zustand eines Patienten oder die Möglichkeiten zum Umgang mit seiner Erkrankung durch die Benutzung der DiGA verbessern.“ Was das im einzelnen ist, geht jede DiGA unterschiedlich an.
Unterscheiden lassen sich die digitalen Gesundheitsanwendungen in zwei Typen:
DiGA mit medizinischem Nutzen – sei es durch den direkten Einfluss auf die Symptome oder auf die Beschwerden einer Erkrankung (z. B. Linderung von Schmerzen) oder durch die Verbesserung der Lebensqualität im Falle einer Krankheit
DiGA mit patientenrelevanten Verfahrens- und Strukturverbesserungen – sei es mit dem Ziel, den eigenen Krankheitsverlauf besser erkennen/verstehen zu können, oder sei es für einen besseren Umgang mit der Krankheit im Alltag (z. B. Medikamentenerinnerungen, Messen und Speichern von Gesundheitswerten oder der Austausch mit dem Arzt)
DiGA im Zusammenspiel mit anderen Geräten und Anwendungen
Es ist gestattet, dass sich die digitalen Gesundheitsanwendungen auch mit anderen Geräten oder anderer Software verknüpfen lassen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn die Anbindung einen entsprechenden Nutzen für den Erfolg der Behandlung oder Therapie hat.
Beispielsweise die DiGA Somnio (gegen Ein-/ Durchschlafstörungen) oder Zanadio (gegen Adipositas) bieten beide die Option an, Fitnessarmbänder, die sich mit dem Smartphone per Bluetooth koppeln lassen, zu integrieren. So lassen sich beispielsweise die Bewegungen während des Schlafens bzw. während Sportübungen in der DiGA festhalten und langfristig dokumentieren. Für Ärzte können diese Daten wertvolle Informationen liefern.
Es ist offen, ob die Hersteller die Anbindung an solche Zusatzgeräte optional anbieten oder ob die App nur mit diesen Hilfsmitteln funktioniert. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass die Krankenkasse auch die Kosten für zusätzliche Geräte übernimmt. Im Falle von Fitnessarmbändern ist es eher unwahrscheinlich, dass die Kasse diese finanziell trägt. Anders schaut es möglicherweise bei bluetoothfähigen Insulinpens oder Blutzuckermessgeräten aus, die sich in die Diabetes-App Esysta einbinden lassen. Sprechen Sie dazu Ihre Krankenkasse an.
Neolexon Aphasie: Sprachtherapie für zuhause
Für Menschen mit einer Sprechstörung dient die DiGA Neolexon Aphasie als logopädische Trainings-App zum täglichen Üben zuhause – ergänzend zur regulären Sprachtherapie. Konkret geeignet ist die Android-/iOS-App bzw. Webanwendung für Patienten mit einer Sprechapraxie (ICD-10-Code R48.2) und/oder einer Aphasie (ICD-10-Code R47.0). Die App bietet Sprech-, Lese-, Schreib- und Verstands-Übungen, die von den behandelnden Ärzten oder Sprachtherapeuten individuell festgelegt und angepasst werden können. Die App wurde vom Hersteller so entwickelt, dass sie sich besonders leicht bedienen lassen soll.
Esysta: Ein Tagebuch für Diabetespatienten
Die DiGA Esysta richtet sich an alle mit der Indikation Diabetes mellitus (ICD-Codes E10 und E11). Die Anwendung greift auf Wunsch die Daten aus Insulinpens sowie Blutzuckermessgeräten, die sich mit Mobilgeräten per Bluetooth koppeln lassen, ab und dient den Patienten als übersichtliches Diabetes-Tagebuch. Ziel der DiGA ist, das Diabetes-Selbstmanagement zu verbessern – und per Ampelfunktion die Gesundheit des Patienten zu optimieren. Idealerweise erhalten Ärzte Zugriff auf die Daten, um die Therapie perfekt abzustimmen. Die DiGA ist für Android und iOS erhältlich, lässt sich aber auch über einen Browser plattformunabhängig nutzen.
Deprexis: Begleitend zur Behandlung von Depressionen
Ergänzend zur Behandlung einer Depression oder depressiven Verstimmungen (aus den ICD-Code-Bereichen F32 und F33) lässt sich die DiGA Deprexis einsetzen. Sie ist ausschließlich als Webanwendung verfügbar und basiert auf verschiedenen psychotherapeutischen Ansätzen und Verfahren. An vorderster Stelle seien laut Hersteller Maßnahmen der kognitiven Verhaltenstherapie. Studien hätten belegt, dass bei Behandlungen mit Deprexis zur Ergänzung deutlich weniger depressive Beschwerden auftraten als bei einer gewöhnlicheren Behandlung ohne die DiGA. Die Webanwendung ist in neun verschiedenen Sprachen verfügbar.
Vivira: Rückenschmerzen dauerhaft reduzieren
Vivira ist eine Android-/iOS-App, die zur Behandlung von Rückenschmerzen eingesetzt werden kann – beispielsweise bei nicht-spezifischen Kreuzschmerzen oder bei einer Arthrose der Wirbelsäule (Osteochondrose). Die Bandbreite der Nutzung ist groß, so dass die DiGA bei 20 verschiedenen Indikationen/ICD-10-Codes aufgeführt wird. Vivira zeigt den Nutzern in Form einer Bewegungstherapie täglich vier Übungen an, die langfristig gesehen, die Rückenschmerzen reduzieren sollen. Die Intensität und Komplexität wird durch Rückmeldung der Patienten entsprechend angepasst. Die Wirksamkeit der DiGA sei laut Hersteller durch eine Studie belegt worden.
Zanadio: Abnehmen bei sehr starkem Übergewicht
Zanadio ist eine App, die bei Adipositas (ICD-Code E66), also sehr starkem Übergewicht anzuwenden ist. Dadurch unterscheidet sie sich klar von gewöhnlichen Abnehm-Apps und kann auch mit entsprechender Diagnose genutzt werden. In einem individuell angepassten 12-Monats-Plan wird man mithilfe eines digitalen Coachs durch die Therapie geführt. Die App ist für Android- und iOS-Geräte verfügbar und unterstützt die optionale Anbindung von Fitness-Armbändern und dergleichen.
Cankado Pro-React Onco: Beschwerden bei Brustkrebs dokumenti
Für Patienten mit einer bösartigen Neubildung der Brustdrüse (ICD-10-Code C50) wurde die DiGA Pro-React Onco von Cankado entwickelt. Verfügbar ist die DiGA für Android und iOS sowie als Webanwendung. Verglichen zu anderen DiGA liegt hier die Dokumentation im Vordergrund: Die Patienten erfassen mit Cankado Pro-React Onco ihre Beschwerden eigenhändig und können den Verlauf langfristig beobachten. Die Daten helfen den Ärzten, die Therapie entsprechend anzupassen. Kleinere Verhaltenshinweise gibt die App jedoch auf Basis der Daten automatisch.
Somnio: Ein- und Durchschlafstörungen reduzieren
Die Gesundheitsanwendung Somnio behandelt Ein- und Durchschlafstörungen und richtet sich an Patienten mit einer nichtorganischen Insomnie (ICD-Code F51.0). Die Android-/iOS-App bzw. Webanwendung vermittelt dem Patienten evidenzbasierte und leitlinienkonforme Inhalte aus dem Bereich der kognitiven Verhaltenstherapie für Insomnie. Die DiGA hilft, richtige Schlafzeiten zu finden, einen individuell abgestimmten Schlaf-Wach-Rhythmus zu optimieren und gibt Tipps und stellt Entspannungstechniken vor. Optional lassen sich auch Schlaftracker des Herstellers Fitbit in die DiGA einbinden (um z. B. den Puls und Schlafbewegungen zu dokumentieren).
Das DiGA-Verzeichnis
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) veröffentlicht alle als DiGA zugelassenen Anwendungen im sogenannten DiGA-Verzeichnis. Dort werden die Anwendungen entsprechend verlinkt sowie umfangreich vorgestellt. Das BfArm schreibt hierzu: “Durch die transparente und übersichtliche Darstellung von Informationen zu den DiGA im Verzeichnis soll zum einen eine vertrauensvolle Nutzung von DiGA durch Patienten ermöglicht werden. Zum anderen sollen diese Informationen Patienten, Ärzten und anderen Leistungserbringern helfen, geeignete DiGA zu finden und ähnliche DiGA miteinander zu vergleichen.“
Jede einzelne DiGA wird mit folgenden Informationen im Verzeichnis aufgeführt:
Hersteller und Name der DiGA
falls zutreffend, die an der Zertifizierung als Medizinprodukt beteiligte Benannte Stelle
medizinische Zweckbestimmung nach Medizinprodukterecht
Gebrauchsanweisung für die DiGA nach Medizinprodukterecht
Zielsetzung, Wirkungsweise, Inhalt und Nutzung der DiGA
Funktionen der DiGA
Hinweise zum Datenschutz und zur Informationssicherheit
Informationen über eventuelle Mehrkosten, beispielsweise für Zubehör oder Funktionen, die auf Wunsch hinzugebucht und selbst bezahlt werden müssen
Voraussetzungen zur Nutzung der DiGA, beispielsweise Hardwareanforderungen oder Versionen des Betriebssystems
weitere Informationen für Fachkreise – beispielsweise Ärzte oder Psychotherapeuten
Rund 30 DiGA werden aktuell (Stand April 2022) im Verzeichnis aufgeführt. Per Suchfunktion lassen sich die jeweiligen Kategorien oder die gewünschten Plattformen herausfiltern.

1. Rezept oder Antrag
Sie als Patient erhalten vom behandelnden Arzt oder Psychotherapeuten ein Rezept für eine spezifische DiGA. Alternativ können Sie im DiGA-Verzeichnis auch eigenhändig nach passenden DiGA suchen und für diese bei der Krankenversicherung einen Antrag stellen. Voraussetzung bei letzterem ist, dass Sie einen Nachweis zu einer entsprechenden Diagnose (mit einer passenden Indikation) besitzen.

2. Prüfung
Die Krankenkasse prüft den Leistungsanspruch und bestätigt Ihnen diesen. Gesetzlich Versicherte erhalten einen sogenannten Freischaltcode von der Krankenversicherung.
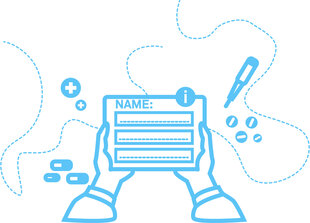
3. DiGA vorbereiten
Laden Sie die DiGA von der entsprechenden Plattform auf Ihr Mobilgerät bzw. rufen Sie im Browser die Webanwendung auf. Legen Sie für die Nutzung der jeweiligen DiGA ein Account an.

4. DiGA nutzen
Gesetzlich Versicherte nutzen den Freischaltcode, um die kostenlose Nutzung der DiGA zu aktivieren und um mit der Anwendung zu starten. Privatversicherte buchen die DiGA zunächst auf eigene Kosten. (Sobald Sie mit der DiGA starten, können Sie bei Ihrer privaten Krankenkasse den Antrag auf Kostenübernahme stellen und somit die vorgeleisteten Kosten zurückerstatten.)

5. Folgerezept
Gegebenenfalls wurde die DiGA zunächst für nur 3 Monate verordnet. Je nach Therapie ist es aber notwendig, eine DiGA längerfristig zu nutzen. In diesem Fall empfiehlt es sich, dass der behandelnde Arzt/Therapeut eine Folgerezept ausstellt. Unter Umständen wird die Fortsetzung einer DiGA auch ohne einem weiteren Rezept von der Krankenkasse genehmigt. Erkundigen Sie sich rechtzeitig nach einer möglichen Fortführung der DiGA.
Kurz erklärt: Digitale Pflegeanwendungen (DiPA)
Neu sind sogenannte DiPA, digitale Pflegeanwendungen. Dies sind Apps oder Webanwendungen, die Pflegebedürftige und deren pflegende Angehörige bei der Bewältigung des Pflegealltags unterstützen. Die Pflegeanwendungen sollen zum Beispiel Tipps in bestimmten Situationen liefern (z. B. Sturzrisikoprävention), Trainingseinheiten vorstellen oder die Kommunikation aller Beteiligten (also Pflegenden, Pflegebedürftigen, Ärzten und Pflegediensten) verbessern. Auch die Anbindung von Sensoren (z. B. durch Blutzuckermessgeräte oder bei Inkontinenzmaterialien) ist prinzipiell möglich.
DiPA gibt es offiziell seit Beginn 2022, wobei es die ersten Anwendungen erst Mitte des Jahres zur Verfügung standen. Sie werden wie DiGA vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte überprüft und zugelassen, sind aber nicht rezeptpflichtig. Veröffentlichte DiPA können von Pflegenden und Pflegebedürftigen frei genutzt werden, die Pflegeversicherung beteiligt sich mit bis zu 50 Euro pro Monat an den Kosten der DiPA. Die Kostenübernahme muss im Vorfeld – genauso wie bei anderen Pflegehilfsmitteln – bei der Pflegeversicherung beantragt werden.
Gesetzlich geregelt werden die DiPA über § 64j SGB XII (zwölftes Sozialgesetzbuch) sowie § 78a SGB XI (elftes Sozialgesetzbuch).